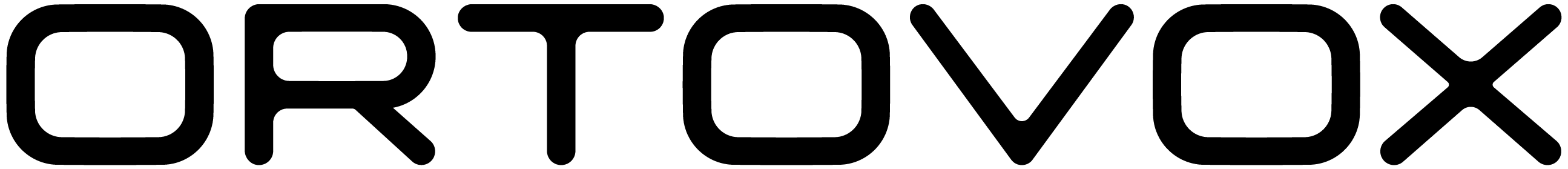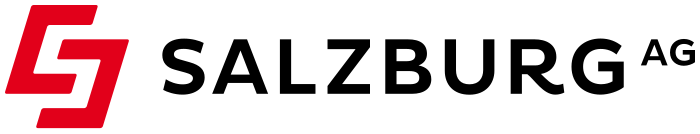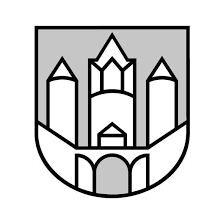Berichte
Die Landesversammlung, das wichtigste Gremium unserer gemeinnützigen Rettungsorganisation tagt ordentlich 1 mal jährlich und beschließt und entscheidet über die wesentlichen Neuerungen und Änderungen in der Salzburger Bergrettung.
Richard Freicham als Landesleiter der Salzburger Bergrettung bestätigt08.10.25 Allgemein Richard Freicham wurde zum Landesleiter und Joachim König zu seinem 2. Stellvertreter gewählt. Richard Freicham als Landesleiter der Salzburger Bergrettung bestätigt Bei einer außerordentlichen Landesversammlung des Österreichischen Bergrettungsdienstes, Landesorganisation Salzburg, ist am Montag der bisherige interimistische Landesleiter Richard Freicham zum Landesleiter gewählt worden. Damit wurde er für die nächsten drei Jahre als Landesleiter bestätigt. Freicham hatte am 8. Mai die Funktion des Landesleiters in Einvernehmen mit den Referenten und Bezirksleitern der Salzburger Bergrettung interimistisch übernommen. Der 60-jährige Bergretter aus dem Pongau ist im Zivilberuf beim Österreichischen Bundesheer in St. Johann im Pongau tätig. Als ehemaliger Leiter der Bergrettungsortsstelle St. Johann im Pongau sowie ehemaliger stellvertretender Landesleiter und langjähriger Bergretter bringt er viel Erfahrung für die Belange der Bergrettung mit. Joachim König zum zweiten stellvertretenden Landesleiter gewählt In der nicht öffentlichen Sitzung am Montag wurde Joachim König, Bergretter der Ortsstelle Muhr im Lungau, zum zweiten stellvertretenden Landesleiter gewählt. Der 44-jährige Berufssoldat bringt in die Landesleitung seine Expertise auch als Ausbildungs- und Einsatzleiter der Ortsstelle Muhr, Hundeführer bei der Hundestaffel und als ehemaliger stv. Bezirksleiter der Bergrettung Lungau ein. Richard Freicham zur Seite steht Wolfgang Gadermayr von der Ortsstelle Hallein. Der 60-jährige Halleiner wurde bereits im April von der Landesversammlung zum ersten stellvertretenden Landesleiter gewählt. Er hat als langjähriger Bergretter ebenfalls viel Erfahrung, von Beruf ist er Ziviltechniker. „Agenda 2028“ Gadermayr skizzierte die zukünftigen Herausforderungen der Salzburger Bergrettung unter dem Titel „Agenda 2028“. Eckpunkte sind unter anderem die Erhaltung der Bergrettung als zivile Freiwilligenorganisation, transparente Entscheidungen, Entlastung der Funktionäre und Stärkung der Ortsstellen, Erhaltung und Anpassung des hohen Ausbildungsniveaus und Erhaltung der Finanzierung im Drei-Säulen-Prinzip (Einsatzverrechnung nach dem Landesrettungsgesetz, Fördererbeiträge, Spenden, Zuwendungen, Rettungseuro). Rund 1.450 Bergretterinnen und Bergretter einsatzbereit Zirka 1.450 ehrenamtliche, aktive Bergretterinnen und Bergretter stehen im Bundesland Salzburg professionell für Einsätze zur Verfügung. „Wenn es zu einem Katastrophenfall kommt, sind alle bereit, mitzuhelfen. Jede Ortsstelle in Salzburg, vom Flachgau bis in den Lungau, ist bereit, gemeinsam die Zukunft zu bestreiten“, erklärte Gadermayr. „Die statutenmäßig festgelegten Aufgaben der Bergrettung bestehen darin, verunglückte, vermisste oder in Not geratene Personen zu retten, zu versorgen und zu bergen. Jeder Bergsteiger oder jeder Bergsteigerin, welcher bzw. welche in Not geraten oder auf Hilfe angewiesen ist, kann sich sicher sein, dass diese Hilfe auch kommt. Bei schlechten Wetterverhältnissen kann sich die Zustiegszeit zu den Hilfesuchenden naturgemäß verlängern. Die Einsatzkräfte der Bergrettung werden jedoch alles versuchen, um diese Hilfe raschestmöglich zu gewährleisten, also zurückgelassen wird niemand.“ Rückblick und Ausblick des Landesleiters Nach erfolgreicher Wahl zog Landesleiter Freicham noch eine Bilanz über die vergangenen sechs Arbeitsmonate und präsentierte einen Ausblick auf 2026. Das Arbeitszeitmanagement sowie die Arbeitsplatzgestaltung für die Beschäftigten in der Landesgeschäftsstelle wurden modernisiert. Ein Teil der neuen Bildschirme zur Verbesserung der digital unterstützten Einsatzleitung wurde bereits an die Ortsstellen ausgeliefert. Die Landesorganisation Salzburg wird im Herbst bei der Alpinmesse in Innsbruck mit einem eigenen Informationsstand vertreten sein. Vorbereitungen für einen Katastrophenhilfszug laufen Der stv. Landesleiter König gab einen Überblick zur aktuellen Planung eines Katastrophenhilfszuges. Ein dafür bereitgestellter Zweckzuschuss des Bundes muss auch zweckgebunden ausgegeben werden. Zur Stationierung der dafür vorgesehenen Einsatz- und Ausrüstungsmittel sind vier Module im Lungau, Pongau, Pinzgau und Salzburg/Tennengau vorgesehen. Die Installierung eines Katastrophenhilfszuges basiert auf dem Bundesgesetz zur Unterstützung von Rettungs- und Zivilschutzorganisationen („Rettungs- und Zivilschutzorganisationen-Unterstützungsgesetz“). Ziel dieses Bundesgesetzes ist es, gesetzlich anerkannte Rettungsorganisationen sowie deren Dachorganisationen bei deren Investitionen zur Steigerung ihrer Resilienz und Leistungsfähigkeit im Krisen- und Katastrophenfall sowie den Österreichischen Zivilschutzverband – Bundesverband (ÖZSV) bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben zu unterstützen. Ermöglicht werden sollen Investitionen zur Steigerung ihrer Resilienz und Leistungsfähigkeit im Krisen- und Katastrophenfall – insbesondere für den Ankauf von Einsatzfahrzeugen, Einsatzmitteln sowie von Ausrüstung und Infrastruktur. Fotos: Bergrettung Salzburg |
    | Thomas Hauer neuer Landesleiter – Einsatzstatistik 202413.04.25 LV-JHV Bei der 78. Landesversammlung der Salzburger Bergrettung wurde die Landesleitung neu gewählt. Mehr Einsatzstunden, mehr Tote, aber etwas weniger Verletzte – Neuwahl der Landesleitung am 12. April: Thomas Hauer folgt auf Landesleiter Balthasar Laireiter, der seine Funktion zurückgelegt hat. Einsatzstatistik 2024 Das Jahr 2024 war für die Einsatzkräfte der Salzburger Bergrettung ereignisreich und herausfordernd. Mit 782 Einsätzen gab es nahezu gleich viel Einsätze wie im Jahr 2023 (788). Was jedoch auffällt, sind die 13.124 geleisteten Einsatzstunden und damit um 973 mehr als 2023 (12.151). Leider hat sich auch die Zahl der Toten markant erhöht: 55 Menschen konnten nur mehr tot geborgen werden, um 20 mehr als 2023 (35). Die Zahl der geborgenen Personen und Verletzten ist etwas zurückgegangen. Von den 670 geborgenen Personen (2023: 726) waren 299 verletzt (338) und 316 unverletzt (353). Häufigste Unfallursache sind nach wie vor Stürze und Abstürze, im Sommer wie auch im Winter. Im Vergleich zu 2023 waren mit 5.206 Bergretterinnen und Bergretter auch um 360 mehr im Einsatz (4.566). Auffallend ist die erhöhte Zahl an Todesfällen. Der bisherige Landesleiter Balthasar Laireiter führt dies auf die relativ vielen Forstunfälle und internen Notfälle (zum Bespiel Herzinfarkt) und auch Abstürze zurück. Die meisten Unfälle ereigneten sich beim Wandern und Bergsteigen, gefolgt von Unfällen auf der Skipiste und bei Skitouren. Die meisten tödlichen Unfälle ereigneten sich ebenfalls beim Wandern und Bergsteigen, auf Platz folgen „sonstige Unfälle“ (z.B. Forstunfälle, Paragleiter-Abstürze), auf Platz drei Unfälle bei Skitouren. Das Nationenranking bei den tödlich Verletzten führt Österreich an, gefolgt von Deutschland. Fehlerhafte Tourenplanung, mehr Sucheinsätze, herausfordernde Einsätze Die gestiegene Zahl an Einsatzstunden ist vor allem den zahlreichen Sucheinsätzen und herausfordernden Bergungen bei Schlechtwetter und Dunkelheit geschuldet. „Wir hatten mehr Sucheinsätze, die sehr zeitintensiv sind und den Einsatz von vielen Bergretterinnen und Bergrettern erfordern“, erklärt Laireiter. Er nennt ein Beispiel: Im August 2024 wurde am Katschberg im Lungau eine Frau vermisst. Sie wurde tagelang von den Einsatzkräften gesucht, rund 1.000 Einsatzstunden wurden geleistet. Die Vermisste konnte erst vor rund drei Wochen in Rennweg (Kärnten) tot aufgefunden werden, nachdem ein Tourengeher zufällig ihren Rucksack entdeckt hatte. Sucheinsätze werden laut Laireiter häufig aufgrund fehlender oder mangelnder Tourenplanung ausgelöst. Überforderung, Übermüdung, Erschöpfung, Verirren, oder gar Abstürze der Betroffenen sind die Folge. Touren werden fortgesetzt, obwohl sich das Wetter verschlechtert oder die Dunkelheit bereits eingesetzt hat. Ein Weitergehen im knie- bzw. hüfthohen Schnee ist kräftezerrend. Beim Queren gefrorener Altschneefelder im Steilgelände ist die Absturzgefahr groß. Auch die Gewittergefahr wird gerne unterschätzt. „Wenn im Sommer laut Wettervorhersage ab 14 Uhr Gewitter aufziehen, sollte man um diese Zeit schon daheim oder in der Hütte sein“, gibt Laireiter zu bedenken. Kaum geht ein Gewitter in den Bergen nieder, muss die Bergrettung innerhalb von fünf Minuten zu vier bis fünf Einsätzen ausrücken. „Das sind auffallende Fakten im Jahr 2024: Typisches Fehlverhalten bei Schlechtwetter- und Gewittervorhersagen. Die Leute gehen trotzdem weiter, drehen nicht um. Wichtig ist eine gute Tourenplanung, auf die Wetterbedingungen zu achten und den Hausverstand einzusetzen.“ Teils müssen Personen aus unwegsamem Gelände anhand aufwendiger Seilbergungen gerettet werden. Schlechtes Wetter, starker Wind und Dunkelheit, bei dem Rettungsflüge meist nicht möglich sind, erschweren den terrestrischen Einsatz. Auf Unverständnis stößt auch die „Vollkaskomentalität“ von einigen Geretteten. Der aufbrechende Permafrost im Hochgebirge wird immer mehr zum Problem, auch für erfahrene Alpinistinnen und Alpinisten: Wegbrechende Steine oder Felsen haben bereits zu schweren oder gar tödlichen Bergunfällen geführt. Bilanz Wintersaison 2024/2025: „Der Winter ist relativ ruhig verlaufen“, sagt Laireiter. Es gab weniger Lawinenunfälle, bedingt offenbar durch eine geringere Schneelage. Es wurden aber dennoch elf Lawineneinsätze verzeichnet. Bereits im September, als eine Kaltfront für starke Schneefälle sorgte, kam es zu tödlichen Unfällen in Obertauern und Hüttschlag. In der Wintersaison rückte die Bergrettung insgesamt zu 271 Einsätzen aus, 4.127 Einsatzstunden waren dafür erforderlich. 13 Tote sind zu beklagen. Einsatzreichster Bezirk war der Pongau, gefolgt vom Pinzgau. Auffallend war, dass viele Einsätze in Bergnot geratene Touristen betroffen haben (an erster Stelle Touristen aus Österreich, gefolgt von Deutschland). Auffallend waren auch die teils schlechte Tourenplanung bzw. Ausrüstung der Verunfallten. Rund 1.460 aktive Bergretterinnen und Bergretter Tag und Nacht einsatzbereit Mit Stand April 2025 gibt es 1.464 aktive Bergretterinnen und Bergretter im Land Salzburg. 17.511 Förderer unterstützen die Salzburger Bergrettung. Mit einem Beitrag von aktuell 36 Euro ist jeder Förderer (inklusive Familie) gegen anfallende Bergungskosten versichert (Höchstbetrag pro Person: 25.000 Euro). Fünf bis sechs Prozent der Einsatzrechnungen uneinbringlich Nicht immer ist es möglich, die Kosten für Einsätze von den Verunfallten bzw. deren Angehörige einzubringen. Im Jahr 2024 wurden 532 Einsatzrechnungen mit einem Volumen von 545.316 Euro ausgestellt, davon waren die Kosten von 33 Einsätzen in Höhe von rund 115.742 Euro uneinbringlich. Zum Vergleich: Im Jahr 2023 waren von 544 Einsatzrechnungen mit einem Volumen von 570.960 Euro 30 Einsätze mit einem Volumen von 69.701 Euro uneinbringlich. Damit sind fünf bis sechs Prozent der Einsatzrechnungen offen bzw. uneinbringlich. Nur etwa 3,4 Prozent der Geborgenen hatten eine Versicherung durch eine Förder-Mitgliedschaft (36 Euro für Familie). Nur rund 25 Prozent hatten überhaupt eine gültige Versicherung. Neuwahl der Landesleitung und deren Referenten Bei der Landesversammlung der Salzburger Bergrettung am 12. April im Sporthotel Wagrain fand auch die Neuwahl der Landesleitung statt. Zirka die Hälfte der Mitglieder der Landesleitung ist nach langjähriger, ehrenamtlicher Tätigkeit nicht mehr zur Wahl angetreten. Der Wahlvorschlag wurde einstimmig angenommen. Balthasar Laireiter, seit 2016 Landesleiter der Salzburger Bergrettung, legte am Samstag seine Funktion nach neun Jahren zurück. Bei der Landesversammlung wurde sein jahrzehntelanger, ehrenamtliche Einsatz im Dienst der Bergrettung und damit an in Not geratenen Menschen gewürdigt. Landesrätin Daniela Gutschi, die für das Rettungswesen ressortzuständig ist, überreichte ihm das Große Verdienstzeichen des Landes. Laireiter war von 1978 bis 2016 Leiter der Bergrettungsortsstelle Muhr im Lungau, von 1992 bis 2016 Bezirksleiter der Bergrettung Lungau, von 2013 bis 2016 stellvertretender Landesleiter, und seit 2016 Landesleiter. Zu seinem Nachfolger wurde sein bisheriger Stellvertreter Thomas Hauer aus Unken einstimmig gewählt. Der Direktor der HAK und HLPS in Zell am See war sechs Jahre lang Leiter der Bergrettungsortsstelle Unken und seit Oktober 2020 stellvertretender Landesleiter. Er ist aktiver Bergretter seit 4. August 1992. Weitere Ergebnisse der Neuwahl Landesleiter-Stellvertreter: Wolfgang Gadermayr und Richard Freicham. Ausbildung und Ausrüstung: Referatsleiter Christian Bauer, Stellvertreter Hans-Peter Breuer und Wolfgang Rohrmoser; Canyoning: Leiter Nord Markus Maurer, Leiter Süd Ingo Gugl. Bergrettungshunde: Referatsleiter Thomas Zeferer, Stellvertreter Stefan Aigner und Johannes Rainer. Referatsleiter Finanzen: Martin Malter. Referatsleiter Peers: Hubert Kreer, Stellvertreter Heinz Leitinger. Referatsleiter Recht und Gesetz: Alexander Bosio. Referatsleiter Sanitätswesen/Landesarzt: Wolfgang Farkas, Stellvertreter Paul Wilhelm. Referatsleiter Technik: Axel Ellmer. Referatsleiter EDV: Bernhard Bachmayer. Referatsleiterin Öffentlichkeitsarbeit: Vera Reiter, Stellvertreterin Maria Riedler. Ehrungen langjähriger Funktionäre Für ihre langjährige, verdienstvolle ehrenamtliche Tätigkeiten beim ÖBRD Salzburg wurden auch die scheidenden Funktionäre/Funktionärinnen von Landesrätin Gutschi geehrt. Das Verdienstzeichen des Landes bekamen Klaus Wagenbichler (stv. Landesleiter), Gerhard Pfluger (Referatsleiter Ausbildung, Ausrüstung), Joachim Schiefer (Referatsleiter Sanitätswesen/Landesarzt), Bernd Kranabetter (Referatsleiter EDV) und Maria Riedler (Referatsleiterin Öffentlichkeitsarbeit, sie ist nun als stellvertretende Referatsleiterin Öffentlichkeitsarbeit tätig) überreicht. Zudem wurde der Leiter der Bergrettung des Bezirks Pongau, Gerhard Kremser, vom Pongauer Bezirksfeuerwehrkommandanten Robert Lottermoser mit dem „Verdienstzeichen 3. Stufe“ des Landesfeuerwehrverbandes Salzburg ausgezeichnet. Neu besetzt wird die Leitung der Geschäftsstelle der Salzburger Bergrettung. Mit 1. August geht der bisherige Leiter Peter Gruber in den verdienten Ruhestand. Sein Nachfolger, Manfred Grabner, ist als ehemaliger Leiter der Ortstelle Strobl und ehemaliger Bezirksleiter-Stellvertreter Flachgau mit den Belangen der Bergrettung bestens vertraut. Er übernimmt seit Jahresbeginn 2025 sukzessive die Funktion des Geschäftsstellenleiters. Balthasar Laireiter zieht zum Abschied Bilanz In seinem Rückblick sind ihm einige prägende Vorkommnisse in Erinnerung. Zu Beginn seiner Funktion als Landesleiter musste ein finanzieller Abgang der Salzburger Bergrettung in Höhe von 500.000 Euro bewältigt werden, die vor allem durch die Kosten für das damals neue Büro in der Sterneckstraße in Salzburg und der Endgeräte des Digitalfunks entstanden sind. Mit Unterstützung des Landes und der Gemeinden konnte das Finanzloch gestopft werden, zudem wurde die Grundfinanzierung auf neue Beine gestellt. Die Bergrettung wurde im Salzburger Landesrettungsgesetz verankert und die Subvention des Landes verdoppelt. Heute kann die Salzburger Bergrettung auf eine gute finanzielle Grundlage blicken. Um ein Drittel mehr Einsätze Was die Einsätze betrifft, so sind diese in den neun Jahren seiner Tätigkeit als Landesleiter von rund 600 auf nunmehr rund 800 im Jahr gestiegen. „Es gibt jetzt also um rund ein Drittel mehr Einsätze, bedingt dadurch, dass mehr Leute in den Bergen unterwegs sind.“ Auch die Coronapandemie habe diesem Trend noch einen Schub gegeben. Schwieriger geworden ist allerdings das Einbringen der Einsatzkosten. „Die Dankbarkeit endet, wenn die Rechnung kommt.“ Uneinbringlich sind die Einsatzkosten auch dann, wenn Vermisste trotz aufwändiger Suchaktionen nicht gefunden werden. „Mit einem lachenden und einem weinenden Auge“ hat Laireiter nun Abschied genommen. „Ich bin nicht mehr so belastbar wie vor neun Jahren, ich bin jetzt 73 Jahre alt.“ Probleme zu bewältigen, das gehöre in jüngere Hände gelegt. „Nach neun Jahren tut eine Orientierungsfrage gut. In der künftigen Entwicklung der Bergrettung sollen jüngere Leute ihren Beitrag einbringen.“ Das weinende Auge betreffe die vielen schönen Erlebnisse und die gute Kameradschaft unter den ehrenamtlichen Bergretterinnen und Bergretter. „Sie arbeiten die Einsätze sehr professionell ab.“ Thomas Hauer skizziert zukünftige Herausforderungen Die Bergrettung wird in Zukunft mit einigen Herausforderungen konfrontiert werden, sagt der neue Landesleiter. Aufgrund des Klimawandels werden die objektiven Gefahren am Berg wie Steinschlag und Felssturz sowie Starkregenereignisse mit Muren und Gewitter zunehmen. Diese Umwelteinflüsse können zum Teil auch Wanderwege zerstören und damit eine erhöhte Absturzgefahr bewirken. „Weitere Herausforderungen sind der anhaltende Trend zum Bergsport, die Reaktion auf veränderte Freizeitaktivitäten (Trailrunning, Klettersteige, E-Bike), die Digitalisierung und der verstärkte Katastrophenschutz, auf den wir uns derzeit vorbereiten.“ Dafür werden vom Bund zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt. Wichtige Aufgabenstellungen seien auch die Erhaltung einer gesicherten Finanzierung, die Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit, der administrative Mehraufwand bei Einsätzen und eine noch stärkere Vernetzung mit den anderen Einsatzorganisationen.“ Die unentgeltliche Arbeit der Ehrenamtlichen Bergrettungskräfte muss laut Hauer auch in Zukunft von den politischen Entscheidungsträgern anerkannt und wertgeschätzt werden. Die Ausstattung der Ortsstellen mit Fahrzeugen und modernen Bergrettungsheimen, die Erhaltung des Personalstandes und die professionelle Vorbereitung auf Katastrophen muss finanziell gesichert sein. Eine kontinuierliche Weiterentwicklung ist entscheidend „Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bergrettung kurzfristig vor allem eine Sicherung der finanziellen Basis und eine Optimierung der Einsatzabläufe benötigt, während langfristig die Anpassung an den Klimawandel, den demografischen Wandel und die technologische Entwicklung im Vordergrund stehen. Eine kontinuierliche Weiterentwicklung in allen Bereichen ist entscheidend, um auch in Zukunft eine professionelle und effiziente Hilfe in den Bergen gewährleisten zu können.“ Leidenschaft für Berge und Bergrettung Dass Hauer in einer schnelllebigen und intensiven Arbeitswelt noch zusätzlich die ehrenamtliche Funktion eines Bergrettung-Landesleiters übernimmt, begründet er mit seiner starken Verbundenheit und Leidenschaft für die Berge und die Bergrettung. „Eine tiefe persönliche Beziehung zur Bergwelt und der Wunsch, Menschen in Not zu helfen. Ich bin mir der lebensrettenden Bedeutung der Organisation bewusst, werde aktiv weiter machen und in der neuen Funktion dazu beitragen, diese zu sichern und weiterzuentwickeln.“ Die Führungskompetenzen, die er in seinem Beruf erlernt hat und aufbringt, werden ihm auch in der Position des Landesleiters der Bergrettung behilflich sein. Diese Funktion bringt ihm zugleich auch einen sinnstiftenden Ausgleich zur Arbeitswelt. „Trotz einer intensiven beruflichen Tätigkeit kann das Ehrenamt in der Bergrettung einen wichtigen Ausgleich bieten und ein Gefühl der Erfüllung und Sinnhaftigkeit vermitteln. Die Zusammenarbeit mit engagierten Bergrettern und Bergretterinnen und die Zugehörigkeit zu einer starken Gemeinschaft ist für mich eine große Motivation. Der Wunsch, die Bergrettung im eigenen Bundesland positiv zu beeinflussen und weiterzuentwickeln, gehört sicherlich auch dazu. Natürlich möchte ich auch als Vorbild dienen und andere dazu inspirieren, sich ehrenamtlich zu engagieren.“ Potenzial für positive Veränderungen „Es ist wahrscheinlich eine Kombination aus mehreren dieser Faktoren, die mich dazu motiviert, eine so anspruchsvolle ehrenamtliche Aufgabe zusätzlich zu einer fordernden Berufstätigkeit zu übernehmen. Der starke Wunsch, einen Beitrag zur Sicherheit in den Bergen zu leisten und Verantwortung für eine wichtige Organisation zu übernehmen, steht dabei wie erwähnt im Vordergrund.“ Ein offener und respektvoller Umgang mit verschiedenen Ansichten fördere konstruktive Diskussionen und bessere Entscheidungen. „Jeder einzelne bringt wertvolle Perspektiven ein.“ Wesentlich für Hauer ist auch, Vertrauen aufzubauen, die Werte der Organisation vorzuleben, die Belastungen und Herausforderungen der ehrenamtlichen Tätigkeit zu verstehen und zu berücksichtigen und den Teamgeist und den Zusammenhalt zu fördern. Derzeit genügend Bergrettungskräfte für Einsätze „Die Salzburger Bergrettung hat derzeit glücklicherweise kein Nachwuchsproblem. Natürlich kann es vorkommen, dass einige Ortsstellen hier sich leichter tun als andere. Die Einsatzbereitschaft kann aber jederzeit gewährleistet werden. Zukünftig kann es allerdings notwendig werden, ortsstellenübergreifend Einsätze noch mehr als bisher zu forcieren.“ Auch was die Ausrüstung betrifft, ist die Bergrettung im Land Salzburg sehr gut aufgestellt. „Es wird auf die zukünftigen Herausforderungen ankommen, welche Mitteln noch benötigt werden.“ Zusammenarbeit mit anderen Blaulichtorganisationen „friktionsfrei“ „Meiner Erfahrung nach ist die Zusammenarbeit mit den anderen Blaulichtorganisationen friktionsfrei und wertschätzend. Der gegenseitige Respekt ist sehr hoch. Bei zukünftig abzuhaltenden, gemeinsamen Übungen (auch für den Katastrophenschutz) wird der Ausbau der guten Beziehungen und die Abstimmung im Einsatzgeschehen sicherlich zunehmen.“
Fotos li: Bergrettung Salzburg/M. Riedler und links unten letzte: LMZ/Neumayr/Hölzl |
77. Landesversammlung in Mauterndorf

Die Bergrettung Salzburg rückte im Jahr 2023 zu 788 Einsätzen aus. „Das Einsatzgeschehen hat sich gegenüber dem Jahr 2022 wesentlich erhöht.
„Das Einsatzgeschehen hat sich gegenüber dem Jahr 2022 wesentlich erhöht. 788 Einsätze im Jahr 2023 – das ein starker Zuwachs, obwohl viele Einsätze von Hubschraubern bei Schönwetter erledigt worden sind. Die Bergrettung ist gefragter denn je“, sagte Landesleiter Balthasar Laireiter bei der 77. Landesversammlung der Bergrettung am 6. April in Mauterndorf. Zum Vergleich: Im Jahr 2022 zählte die Bergrettung 730 Einsätze im Bundesland Salzburg, um 58 weniger als im Jahr 2023.
„Immer mehr Menschen wollen ihre Freizeit in den Bergen verbringen, deshalb ist es auch zu mehr Einsätzen gekommen“, erläuterte Laireiter.
Zugenommen haben auch die Einsatzstunden: 12.151 Stunden wurden verbucht, 2022 waren es 10.675. Geborgen wurden 726 Personen, 338 davon haben Verletzungen erlitten. 35 Menschen konnten von den Bergretterinnen und Bergrettern nur mehr tot geborgen werden. Damit ist die Zahl der Totbergungen gegenüber 2022 (26) ebenfalls gestiegen.
Keine tödlichen Lawinenunfälle in vergangenen Wintersaison
Sehr erfreulich ist, dass es in der Wintersaison 2023/24 keine tödlichen Lawinenunfälle gegeben hat. Die Lawineneinsätze von Dezember bis Ende März sind aber in den letzten Jahren gestiegen. So wurden im Winter 2021/22 insgesamt acht Einsätze verzeichnet, 2022/23 waren es 13 und 2023/24 waren es 16. Ein auffallend positiver Trend: zunehmend viele Lawinenabgänge werden der Bergrettung gemeldet, auch wenn es keine Verschütteten gibt. So müssen die Einsatzkräfte weniger ausrücken. Insgesamt gab es in der vergangenen Wintersaison (im Zeitraum von 1. Dezember bis 31. März) 230 Einsätze für die Bergrettung Salzburg, davon 93 im Pongau (2 Tote), 69 Einsätze im Pinzgau (4 Tote), 25 Einsätze im Flachgau (2 Tote), 22 im Tennengau (0 Tote) und 21 im Lungau (2 Tote).
Ranking Unfallursachen
An erster Stelle bei Unfällen im alpinen Gelände steht der Sturz beim Wandern, an zweiter Stelle Verirren. Die meisten Verunfallten stammen aus Österreich (164), auf Platz zwei folgt Deutschland (133).
Die meisten Einsätze im Pongau
Die Einsatzstatistik 2023 führt der Pongau mit 313 an, gefolgt vom Pinzgau mit 238 und dem Flachgau mit 106. An vierter Stelle liegt der Lungau mit 51, an fünfter Stelle der Tennengau mit 50. Die Bergrettungshundestaffel rückten 27-mal im ganzen Land aus, die Canyoning-Einsatzgruppe zweimal.
Viele Unfälle auf mangelnde Tourenplanung zurückzuführen
„Manche Unfälle lassen sich vielleicht nicht vermeiden. Aber prinzipiell sind viele Unfälle auf mangelnde Tourenplanung und -Vorbereitung zurückzuführen“, sagte Landesleiter Laireiter. Auffallend ist, dass die Anzahl von verirrten Bergwanderern steigt. Die Einsätze können vor allem dann herausfordernd werden, wenn die Bergretterinnen und Bergretter bei schlechtem Wetter oder in der Dunkelheit in schwieriges Gelände ausrücken müssen, weil der Rettungshubschrauber witterungsbedingt nicht fliegen kann. „Generell werden viele Einsätze der Bergrettung wegen der erschwerten Bedingungen anspruchsvoller“, gab der Landesleiter zu bedenken.
Überforderung durch Selbstüberschätzung
Selbstüberschätzung ist Thema. Die „Vollkaskomentalität“ spielt dabei oft eine Rolle, wenn man irrtümlich davon ausgeht, dass man ohnehin versichert ist und jederzeit innerhalb von 15 Minuten ein Hubschrauber zur Stelle ist. Eine abgeschlossene Versicherung schützt zwar vor hohen Kosten, aber nicht vor schlechtem Wetter, oder einer fehlerhaften Tourenplanung. Ein weiteres Problem stellen auch soziale Medien, TV-Beiträge oder Werbungen dar. Teils werden die Touren von Profisportlern oder exzellenten Alpinisten präsentiert. Diese Touren können allerdings für Hobby-Sportler zu anspruchsvoll sein. Diese eins zu eins nachzuahmen, kann schwerwiegende Folgen haben.
Rund 2.100 Mitglieder und 17.300 Förderer der Bergrettung Salzburg
Die Bergrettung Salzburg zählte im März 2024 insgesamt 2.104 Mitglieder, 1.962 Männer und 142 Frauen. Im Jahr 2023 haben 17.313 Fördererinnen und Förderer die Bergrettung Salzburg unterstützt. „Sie tragen einen maßgebenden Anteil der Finanzierung unserer Aus- und Fortbildungen“, bedankte sich Laireiter für deren große Unterstützung. Mit einem Beitrag von 32 Euro pro Person und Jahr ist ein Versicherungsschutz für Bergekosten bis zu 25.000 Euro im alpinen Gelände und bei Wassernot gewährleistet.
„Wir sind stolz auf das hohe Niveau unserer umfassenden Ausbildung mit zu absolvierenden Prüfungen“, erklärte der Landesleiter. So stehen in der Bergrettung Salzburg auch die unterschiedlichsten Spezialisten aus Hundeführer, Canyoning-Retter oder Peers-Zuständigen 24 Stunden in Einsatzbereitschaft.
Ehrung Rk-Alt-Landesrettungskommandant Anton Holzer
Beim anschließenden Festakt begrüßte Laireiter die Gäste aus Politik und anderen Einsatzorganisationen wie Rotes Kreuz, Bezirkshauptmannschaft, Polizei, Wasserrettung und Freiwillige Feuerwehr.
Alt-Landesrettungskommandant Anton Holzer wurde für seine Unterstützung und „tollen Zusammenarbeit“ mit der Verdienstmedaille der Bergrettung Salzburg ausgezeichnet. Laireiter: „Wir haben in den letzten Jahren ein sehr gutes Miteinander gehabt. Du hast uns in allen Dingen unterstützt. Die Bergrettung hat in Anton Holzer einen äußerst kompetenten Ansprechpartner beim Roten Kreuz gehabt.“ Es sei u.a. die neue Landesgeschäftsstelle der Bergrettung in der Sterneckstraße in der Stadt Salzburg eingerichtet und finalisiert worden. Laireiter bedankte sich bei Holzer auch für seine große Unterstützung zur gesetzlichen Anerkennung der Bergrettung als besondere Rettungsorganisation im Jahr 2013.
„Es war für mich immer klar, dass die Einsatzorganisationen in Salzburg zusammenarbeiten müssen“, bedankte sich der Alt-Landesrettungskommandant für Verdienstmedaille der Bergrettung, die ihm Laireiter zusammen mit der Ehrenurkunde überreicht hat.
Ebenso ausgezeichnet wurde unser Technik Referent Axel Ellmer (Wagrain).
Als Ortsstellenleiter der Bergrettung Wagrain wurde unter seiner Federführung die neue Einsatzzentrale in Wagrain errichtet. „Das ist eine Vorzeige-Einsatzzentrale im Land Salzburg“, bedankte sich Landesleiter Laireiter bei Ellmer, der auch Bürgermeister in Wagrain ist.
76. Landesversammlung in St. Martin
730 Einsätze mit 10.675 Einsatzstunden im Jahr 2022 – Bilanz der 76. Landesversammlung in St. Martin.
Insgesamt wurden im vergangenen Jahr über 23 verschiedene Lehrgänge (94.325 Ausbildungsstunden) und 1.920 Veranstaltungen mit anspruchsvollen Ausbildungsinhalten und Zielen von besucht. „Wir sind stolz auf das hohe Niveau unserer umfassenden Ausbildung mit zu absolvierenden Prüfungen“, erklärt Landesleiter Balthasar Laireiter. So stehen in der Bergrettung Salzburg auch die unterschiedlichsten Spezialisten aus Hundeführer, Canyoning-Retter oder Peers-Zuständigen 24 Stunden in Einsatzbereitschaft.
Rund 100 Einsätze mehr als im Vorjahr
Ein auffallender Teil der Statistik: „Die Einsätze nahmen 2022 wieder stark zu“, so der Landesleiter. 2022 wurden 730 (2021 waren es 624) Einsätze absolviert, um rund 100 mehr als im Vorjahr. Es waren 2022 insgesamt 4.368 Bergretterinnen und Bergretter im Einsatz.
Von der Bergrettung Salzburg konnten 26 Menschen nur mehr tot geborgen werden. Insgesamt waren es laut Kuratorium für Alpine Sicherheit/BMI Alpinpolizei allerdings 39 Menschen, die in Salzburg im Jahr 2022 im alpinen Gelände – zumeist während der Sommermonate – tödlich verunglückt sind.
Die Hauptunfallfaktoren waren Stürze und Verirren. Am öftesten müssen die Bergretterinnen und Bergretter wegen Unfällen bei Wanderungen und beim Mountainbiken ausrücken.
Auffallend ist, dass immer mehr Einsätze wegen abgestürzter Paragleiter zu bewältigen sind. Das hat auch damit zu tun, dass insgesamt das sportliche Angebot am Berg wächst. Deshalb gelten immer mehr Einsätze Sportarten wie Mountainbiken, Paragleiten, Klettersteiggehen, Canyoning, Traillauf und Skibergsteigen.
Stürzen häufigste Unfallursache
Die Unfälle werden jedenfalls durch verschiedenste Faktoren verursacht: An erster Stelle steht Stürzen, gefolgt von Verirren, medizinischen Notfällen und Erschöpfung.
Gestiegen sind die Einsätze der Bergrettung in Zusammenarbeit mit der Alpinpolizei, dem Hubschrauberteam der Libelle und mit den unterschiedlichsten Teams von Rettungshubschraubern. (130; 2021 waren es 107): „Das ist für unsere Einsatzkräfte eine enorme Erleichterung, da sie so auch viel rascher vor Ort sein können“, sieht Laireiter darin große Vorteile.
Die meisten Einsätze im Pongau
Der einsatzreichste Bezirk war wieder der Pongau (276), gefolgt vom Pinzgau (237), Flachgau (131), Tennengau (47) und den Lungau (39).
Nachwuchsprobleme gibt es erfreulicherweise keine. Im Jahr 2022 absolvierten insgesamt 310 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Kurse der Bergrettung Salzburg: So fanden zwei Alpine-Erste Hilfe-Kurse, zwei Winter-, zwei Fels- und ein Eiskurs sowie Spezialausbildungen und Wochenkurse für die Hundeführer und die Spezialisten der Canyoninggruppe statt.
Viele Unfälle auf mangelnde Tourenplanung zurückzuführen
„Manche Unfälle lassen sich vielleicht nicht vermeiden. Aber prinzipiell sind viele Unfälle auf mangelnde Tourenplanung und -Vorbereitung zurückzuführen“, so Landesleiter Laireiter, der auch auf eine steigende Anzahl von verirrten Bergwanderern hinweist.
Mehr Kameradenrettung nach Lawinenabgängen
Erfreulicherweise nehmen viele Bergsportbegeisterte die präventiven Hinweise der Bergrettung ernst: „Wir beobachten auch in schneearmen Wintern wie heuer – mit weniger Lawineneinsätzen (2022 kam es insgesamt zu 14 Lawineneinsätzen) –, dass immer mehr Skitourengeher den Umgang mit der Notfallausrüstung gut beherrschen und zunehmend häufig so ihren Begleitern das Leben retten.“
Bergekosten 2023
„Die Bergekosten nehmen einen wesentlichen Teil der Finanzierung der Bergrettung ein“, sagte Laireiter. Diese wurden mit 1. Jänner 2023 von 48 Euro auf 52 Euro erhöht. Die Mindestpauschaule für einen Einsatz beträgt seit 1. Jänner dieses Jahres 280 Euro. In Salzburg wurde viel für neue Einsatzfahrzeuge investiert, denn der motorisierte Aufwand der Bergrettung wird immer höher, berichtete Landesleiter Laireiter. Der Einsatz von mehr Einsatzfahrzeugen ist sehr ökonomisch und andererseits sehr wichtig für die Verunfallten, weil die ehrenamtliche Helfer schneller beim Patienten eintreffen.
Wesentlich sind dabei für die ehrenamtlich tätigen Männer und Frauen die vielen Förder-Mitglieder. „Sie tragen einen maßgebenden Anteil der Finanzierung unserer Aus- und Fortbildungen“, bedankt sich Laireiter für deren große Unterstützung.
Zahlreiche Ehrungen und Ehrengäste in St. Martin
Als Ehrengäste begrüßt wurden im Gasthaus zur Post in St. Martin am Tennengebirge Vertreter der Alpinpolizei, des Rotes Kreuzes, der Feuerwehr und der Wasserrettung sowie die Bürgermeister von St. Martin am Tennengebirge, Hüttau und Annaberg. Den offiziellen Teil der Landesversammlung, zu der insgesamt rund 50 Bergretter gekommen sind, beehrten mit ihrem Besuch auch ÖBRD-Bundesverbandspräsident Stefan Hochstaffl und Geschäftsführer Martin Gurdet.
Bernd Tritscher, Bezirksleiter Pinzgau, wurde für 40 Jahre bei der Bergrettung geehrt. Er trat 1983 der Ortsstelle Saalfelden bei, und war später 22 Jahre Leiter der Ortstelle. Als Bezirksleiter hat er eine wichtige Funktion übernommen, er ist im Mittelbau das Bindeglied der Ortsstellen zur Landesleitung, sagte Balthasar Laireiter, der Tritscher das Ehrenzeichen und die Urkunde überreichte.
Ebenso 40 Jahre ist auch der Ortsstellenleiter von Golling, Toni Vidreis, nun engagierter Bergretter.
Weiters wurde auch der Ortsstellenleiter von Neukirchen, Albert Kogler, für 25 Jahre Mitgliedschaft bei der Bergrettung geehrt.
Reinhold Moser, von der Mittersill, ist stolze 40 Jahre Mitglied der Bergrettung!
Wir freuen uns und sind stolz auf diese engagierten Menschen in unseren Reihen!




75. Landesversammlung in Maria Alm
Neuwahlen und Zahlen zum Bergrettungsjahr 2021
Am Samstag, 23. April, fand die 75. Landesversammlung der Bergrettung Salzburg in Maria Alm statt. Auf der Tagesordnung standen auch Neuwahlen. Balthasar Laireiter wurde für die kommenden drei Jahre wiedergewählt.
Der bisherige Landesleiter Balthasar Laireiter wurde wieder für diese Funktion gewählt, als seine Stellvertreter Thomas Hauer (auch Leiter der Ortsstelle Unken) und Klaus Wagenbichler (Bergrettung Saalfelden).
Neu gewählt wurden auch alle Referenten der Bergrettung Salzburg:
In den Referaten Finanzen (Martin Malter, OS Golling), Ausbildung und Ausrüstung (Gerhard Pfluger, OS Saalfelden), Bergrettungshunde (Thomas Zeferer, OS Bad Hofgastein), EDV (Bernd Kranabetter, OS Dienten), Technik (Axel Ellmer, OS Wagrain), Medizin (Joachim Schiefer, OS Tamsweg), Recht (Alexander Bosio, OS Zell am See) und Pressearbeit (Maria Riedler, OS Bischofshofen).
Ehrungen, Jubiläen, neue Funktionäre und Ehrengäste
Geehrt wurde der zurückgetretene Funktionär Hubert Gollner (ehem. Ortsstellenleiter Dorfgastein) sowie für 40 Jahre Bergrettungsdienst Finanzreferent Martin Malter(Golling) und Ortsstellenleiter Paul Hasenauer (Fusch). Hermann Maislinger, Hüttenwirt vom Naturfreundehaus Kolm Saigurn, wurde für besondere Verdienste um die Bergrettung geehrt.
Als neue Ortsstellenleiter stellen sich Hans Peter Harlander (Dorfgastein) und Gerfried Walser (Mittersill) vor
Als Ehrengäste begrüßte LL Laireiter Michael Obermoser (Landtagsabgeordneter und BGM Wals im Pinzgau), Hermann Rohrmoser (BGM Maria Alm), Erich Rohrmoser (BGM Saalfelden), Manfred Höger (Bez. Kat. Ref. Pinzgau), Thomas Schwaiger (Major, LPD Salzburg), Bert Neuhofer (Viz.Präs. RK Salzburg), Anton Voithofer (Bez. Oberrettungsrat Pinzgau – RK Salzburg), Johann Leitinger (Bez. FW-Komm. Stv., BR – FW Salzburg), Markus Zainitzer (Präs – ÖWR Salzburg), Monika Feichtner ( LL – ÖHR Salzburg), Hermann Maislinger (Hüttenwirt Naturfreundehaus Kolm-Saigurn)
Zahlen, Daten und Fakten zum Bergrettungsjahr 2021!
Im Corona-Jahr 2021 um zwei Prozent weniger Einsätze als im Vorjahr.
Trend zum Tourenskilauf gestiegen – 15 Prozent mehr Unfälle. Bergrettungshunde leisteten mehr als doppelt so viele Einsätze
Die Corona-Pandemie wirkte sich auch 2021 auf die Einsatzstatistik der Salzburger Bergrettung aus. Mit dem ersten Lockdown im März sind im Frühling weniger Freizeitsportler in den Bergen unterwegs gewesen als üblich. Damit ist die Gesamtzahl der Einsätze gesunken, auch wenn es im Sommer einen kurzfristigen Anstieg gab. Die rund 1.400 Bergretter und Bergretterinnen der insgesamt 43 Ortsstellen rückten im Jahr 2021 zu 624 Einsätzen aus. Das ist ein Rückgang um etwa zwei Prozent im Vergleich zum Jahr 2020 mit 639 Einsätzen.
Die Bergrettung Salzburg verzeichnete mit 9243 Einsatzstunden in etwa genauso viele wie im Jahr 2020 (9.243). Im Jahr 2021 ist auch die Anzahl der Bergung von tödlich Verunfallten in etwa gleichbleibend hoch. Mit 32 Toten gab es um drei Tote weniger als 2020 (35).
Der Landesleiter der Salzburger Bergrettung, Balthasar Laireiter, weist auf einige Besonderheiten in der aktuellen Wintersaison 2021/22 hin: „Seit Ende 2021 ist der Trend zum Tourenskilauf nochmal gestiegen, was auch zu einer Zunahme der Unfälle um etwa 15 Prozent zu 2020 führte.“
Die Zunahme führte leider auch zu mehr Lawineneinsätzen (27) in den ersten Wochen des Jahres 2021 (2020 – 5). Laireiter bedankte sich in diesem Zusammenhang für die Unterstützung durch die Förderer der Bergrettung: „Nur mit ihrer finanziellen Hilfe können die zum Teil schwierigen Einsätze gestemmt werden.“
Wanderboom und relativ wenig Lawinenunfälle
„Die Hauptursache der Bergunfälle im Jahr 2021 dürfte nach wie vor am anhaltenden Wanderboom liegen“, erklärt Laireiter. Immer mehr Menschen suchen Entspannung und körperliche Fitness in den Bergen, sei es beim Wandern, Bergsteigen, Berglaufen oder Skitourengehen. Dieser Boom spiegelt sich auch in der Statistik 2021 wider. 42 Prozent der 589 Gesamteinsätze betrafen Wander- und Bergunfälle.
Im Frühjahr 2021 war auch der anhaltende Skitouren-Trend (plus 15 Prozent), (2020 etwa fünf Prozent der Gesamteinsätze) spürbar. Die meisten Einsätze nach Monaten gab es im August (107), gefolgt von Juli (66) und September (59).
Auffallend war auch die Steigerung der Anzahl der Arbeitsunfälle, wie etwa Forstunfälle (3 %), 2020 noch 1,7 Prozent.
Die häufigsten Unfallursachen sind nach wie vor der Sturz bzw. Absturz mit 43 Prozent (2020 – 49,5 Prozent), gefolgt von Verirren mit 15 Prozent (2020 – 17,3%). Lawinen nehmen mit fünf Prozent (2020: 0,85 Prozent) auch 2021 nur einen geringen Anteil am Unfallgeschehen ein.
Auffallend im vergangenen Jahr war auch die stark steigende Zahl der Einsätze für die Spezialgruppe Bergrettungshunde (plus 59 %). „Das zeigt einmal mehr, wie wichtig unsere Hundeteams im ganzen Bundesland Salzburg sind“, so der Landesleiter, der dieses zusätzliche und sehr zeitintensive Engagement seiner Hundeführer und Hundeführerinnen in den Reihen der Bergrettung lobend hervorhebt.
Einsätze nach Bezirken: Pongau führend, Zunahme im Lungau
Die meisten Einsätze nach Bezirken fanden – so wie in den Jahren zuvor – im Pongau, gefolgt vom Pinzgau und Flachgau statt. In den Bezirken Tennengau und Lungau nahm die Zahl der Einsätze im Vergleich zu 2020 zu.
Im März 2022 doppelt so viele Einsätze – Vorsicht bei Bergtouren im Frühling und Frühsommer im nordseitigen Bereich
In den ersten drei Monaten des aktuellen Jahren kam es bereits zu 195 Einsätzen – dabei gab es heuer bereits vier Tote im Bereich Skitourengehen und Skilauf. Im Vergleich zum Vorjahr waren etwa im März doppelt so viele Einsätze als 2021. Zahlreiche Einsätze gab es bereits für verunglückte Wanderer und Bergsteiger. „Wir schätzen, dass es heuer wieder noch bis in den Juni hinein besonders in nordseitigen Bereichen vermehrt zu Unfällen kommen kann. Oft unterschätzen Wanderer die Bedingungen in höheren Lagen. Hier können noch bis zum Juni harte Schneefelder oder rutschige Steige vorhanden sein. Daher sollte man auf Tourenplanung und gute Ausrüstung achten. Hilfreich sind Steigeisen, Grödel, kantiges Schuhwerk oder Stöcke“, so Laireiter.
Mehr Bergretter in Ausbildung
Erfreulicherweise nahm auch wieder die Zahl der Frauen und Männer im Probejahr zu. 2021 stieg die Zahl der Bergretter im Probejahr um 59% Prozent (86, davon 12 Frauen) an. Bei den Anwärtern liegt der Anteil der Frauen bereits bei 23 von 160 Anwärtern. Der Gesamtanteil der Frauen in der Bergrettung bei den aktiven Bergrettern (40) macht etwa vier Prozent aus, davon kommen 32,5 Prozent (13) aus dem Bezirk Flachgau. Die Gesamtanzahl der aktiven Bergretter hat gegenüber dem Vorjahr geringfügig zugenommen.
Neben den Einsätzen leisten Salzburgs Bergretter jährlich noch tausende ehrenamtliche Stunden für anspruchsvolle Aus- und Fortbildungen, sowie Hilfsdienste – beispielsweise bei Naturkatastrophen.
Mit 32 Euro Förderbeitrag weltweit versichert
Für einen Förderbeitrag von 32 Euro bietet die Bergrettung dem Einzahler samt seiner ganzen Familie eine äußerst günstige Versicherung für Bergungskosten aus unwegsamem Gelände (Berg- und Wassernot) weltweit. Mit diesem Betrag wird die Finanzierung der Ausrüstung und Ausbildung der Bergretter mitfinanziert. Im Gegenzug stehen allein in Österreich rund 12.600 Bergrettungsleute bereit, Ihnen schnell und effizient nötige Hilfestellung zu leisten: Im Fels, im Eis, auf der Piste und am Wanderweg.
74. Landesversammlung in Salzburg

Finanzen, Jungbergretter und Drohneneinsatz
Auch heuer waren ein umfangreiches Coronakonzept, Überprüfung der drei G’s und Baby-Elefanten-Sicherheitsabstand Voraussetzung für die erfolgreiche Durchführung der 74. Landesversammlung der Bergrettung, die in Salzburg am 29. Mai 2021 stattfand.
Nach den Geschäftsberichten der Landesleitung und der Landesgschäftsstelle wurde über die bereits vorab ausgesandten Anträge abgestimmt. Landesleiter Balthasar Laireiter zeigte sich sehr erfreut, dass alle vier Anträge angenommen wurden. Auch der Bereich „Finanzen“ wurde umfangreich vorgestellt. Einen Teil der Landesversammlung widmeten die fünf Bezirksleiter unter anderem dem Einsatzgeschehen in ihren Bezirken.
Ausfallen musste coronabedingt auch dieses Jahr der öffentliche Teil der Landesversammlung.
Nach Sommerhoch Rückgang der Einsätze
Die Corona-Pandemie wirkt sich auf die Einsatzstatistik der Salzburger Bergrettung 2020 aus. Mit dem ersten Lockdown im März sind im Frühling weniger Freizeitsportler in den Bergen unterwegs gewesen als üblich. Damit ist die Gesamtzahl der Einsätze gesunken, auch wenn es im Sommer einen kurzfristigen Anstieg gab und die Wanderunfälle zunahmen. Die rund 1.400 Bergretter und Bergretterinnen der insgesamt 43 Ortsstellen rückten im Jahr 2020 zu 639 Einsätzen aus. Das ist ein Rückgang um etwa 19 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019 mit 793 Einsätzen.
Starker Anstieg der Einsätze im Lungau und Flachgau
In den Bezirken Flachgau (5 Ortsstellen) und Lungau (4 Ortsstellen) nahm die Zahl der Einsätze im Vergleich zu 2019 um 9,5 bzw. 53,3 Prozent zu. Die meisten Einsätze in absoluten Zahlen fanden so wie in den Jahren davor im Pongau (16 Ortsstellen), gefolgt vom Pinzgau (14 Ortsstellen) statt.
Noch mehr Ausbildungskurse gefragt
„Trotz Corona konnten 2020 alle Grundausbildungen abgehalten werden,“ stellte Ausbildungsleiter Gerhard Pfluger erfreut fest. „Erfreulicherweise nimmt auch seit einigen Jahren die Zahl der Frauen und Männer in der Ausbildung zum Bergretter bzw. zur Bergretterin zu. 2020 stieg die Zahl der Bergretter in Ausbildung um 14 Prozent an. Es müssen daher zukünftig noch mehr Ausbildungskurse angeboten werden“, so der Ausbildungsleiter. Die Gesamtanzahl der Bergretter hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.
Landesleiter Balthasar Laireiter bedankte sich in diesem Zusammenhang für die Unterstützung durch die Förderer der Bergrettung, „denn nur mit ihrer finanziellen Hilfe können die zunehmenden Ausbildungskosten und die zum Teil schwierigen Einsätze gestemmt werden.“
Viele ehrenamtliche Stunden für Ausbildungen und Hilfsdienste
Neben den Einsätzen leisten Salzburgs Bergretter jährlich noch tausende ehrenamtliche Stunden für anspruchsvolle Aus- und Fortbildungen, sowie Hilfsdienste – beispielsweise bei Naturkatastrophen.
Drohnen zur Unterstützung im Bergrettungseinsatz?:
Paul Mörwald (OS Werfen), Mitglied der Drohnen BOS Gruppe, berichtete über interessante Aspekte zu Drohneneinsätzen und informierte über den aktuellen Stand des EU Projektes.
Förderer und Sponsoren: Zahlen und Einnahmen steigen
Wie in den Jahren davor konnte auch dieses Jahr die Zahl der Förderer (17.783) und Sponsoren der Bergrettung und somit die Einnahmen aus diesem Sektor gesteigert werden.
Vorstellung neuer Funktionäre
Im letzten Jahr gab es auch Wechsel auf Funktionärsebene in den Ortsstellen. Landesleiter Balthasar Laireiter freute sich über die ambitionierten Bergretter und bedankte sich bei Altfunktionär Hans Schaidreiter
Neuer Ortstellenleiter:
- Kleinarl: Wilfried Gschwandtl (Alt OL Hans Schaidreiter)
Ehrungen:
ehem. Ortsstellenleiter: Hans Schaidreiter (Kleinarl)
Seit fast 40 Jahren bei der Bergrettung leitete Hans 17 Jahre lang die Ortsstelle Kleinarl.
25 bzw. 50 Jahre für die Bergrettung
Geehrt wurde für 25 Jahre Bergrettungsdienst der anwesende Ortsstellenleiter Matthias Schilchegger (Obertauern) sowie für 50 Jahre Bergrettungsdienst Altlandesleiter und jetziger Ortsstellenleiter Stellvertreter Estolf Müller (St. Gilgen)
Im Land Salzburg gab es 69 Jubilare, davon 12 Bergretter, die bereits über 60 Jahre dabei sind.
73. Landesversammlung in Salzburg
Finanzen, steigende Einsatzzahlen und Corona: ein herausforderndes Bergrettungsjahr geht zu Ende



Coronatest und Baby-Elefanten-Sicherheitsabstand ermöglichten Durchführung der 73. Landesversammlung.
Testteam unter Leitung von DI. Roland Schimpke (2.v.re.) und Dr. Paul Wilhelm (1. v.li.): Weiters: Mag. Maria Riedler, Manfred Grabner, Mag. Claudia Hutticher25 Jahre Bergrettungserfahrung: Johann Schaidreiter (OL Kleinarl), Balthasar Laireiter (Landesleiter), Martin Wallinger (OL Abtenau), v. li. na. re.Coronatest und Baby-Elefanten-Sicherheitsabstand ermöglichten Durchführung der 73. Landesversammlung.
Nachdem alle Teilnehmer vor Sitzungsbeginn negativ getestet waren, konnte die 73. Landesversammlung mit entsprechenden Sicherheitsabständen als Arbeitssitzung am 3. Oktober doch noch durchgeführt werden. Nach den Geschäftsberichten der Landesleitung und der Landesgschäftsstelle wurde über die Anträge abgestimmt, unter anderem:
Personelles: 2. Landesleiter Stellvertreter gewählt
Als 2. Landesleiter Stellvertreter wählten die Versammlungsteilnehmer einstimmig MMAg.Thomas Hauer, Ortsstellenleiter von Unken. Heinz Leitinger und Reinhold Moser wurden als neue Rechnungsprüfer, Ingo Gugl als Landesausbildungsleiter Stellvertreter und Landescanyoningleiter Stv. und Wolfgang Russegger ebenfalls als Landescanyoningleiter Stv. bestätigt. Ein Dank gilt Anton Brandauer für seinen jahrelangen Einsatz alsLandesausbildungsleiter Stellvertreter und Landescanyoningleiter.
Einsatzrekord der Bergrettung Salzburg im Jahr 2019
So viele Einsätze wie noch nie leisteten Salzburgs Bergretter im Jahr 2019. Die insgesamt 43 Ortsstellen und die Spezialgruppen wie Bergrettungshunde und Canyoninggruppe rückten zu 793 Einsätzen aus. Das ist ein Anstieg um fast sechs Prozent im Vergleich zum Jahr 2018 mit 749 Einsätzen. Trotz Corona „Ausgangssperre“ rückten die Einsatzkräfte auch 2020 bis 1. Oktober bereits 552 mal aus.
Erhöht hat sich auch die Zahl der Einsatzstunden, und zwar um mehr als 5.000. Die rund 1.400 Bergretter verzeichneten 15.031 Einsatzstunden (2018: 9.754 ). Zu bedauern ist, dass die Anzahl der Bergung von tödlich Verunfallten um 54 Prozent gestiegen ist – von 28 im Jahr 2018 auf 43 im Jahr 2019.
Mehr Bergretter in Ausbildung,
Erfreulicherweise nimmt auch seit einigen Jahren die Zahl der Frauen und Männer in der Ausbildung zum Bergretter bzw. zur Bergretterin zu: „Wir bieten deshalb jährlich zwei Fels- und Winterkurse, sowie zwei Kurse in der Alpinen Erste-Hilfe-Ausbildung an“, betont der Landesleiter. 2019 stieg die Zahl der Bergretter in Ausbildung (plus 18 Prozent) um fast ein Fünftel an.
Hilfsdienste in der Corona Krise
Neben den Einsätzen leisten Salzburgs Bergretter jährlich noch tausende ehrenamtliche Stunden für anspruchsvolle Aus- und Fortbildungen, sowie Hilfsdienste – beispielsweise bei Naturkatastrophen. Bergretter absolvierten in der Corona Krise ebenfalls freiwillige soziale Dienste in den Gemeinden, etwa für Lebensmittel, Medikamenten- und Krankenbett-Transporte.
Förderer und Sponsoren: Zahlen und Einnahmen steigen
Auch dieses Jahr konnte die Zahl der Förderer und Sponsoren der Bergrettung und somit die Einnahmen aus diesem Sektor gesteigert werden.
Vorstellung neuer Funktionäre
Im letzten Jahr gab es auch Wechsel auf Funktionärsebene in den Bezirken und Ortsstellen. Landesleiter Balthasar Laireiter freute sich über die ambitionierten Bergretter. Die Danksagung an die Altfunktionäre musste Corona bedingt ausfallen.
In den Bezirken:
- Tennengau: Bezirksleiter Werner Quehenberger (Alt BL Wilfried Seidl)
Neue Ortstellenleiter:
- Annaberg: Anton Kendlbacher (Alt OL Werner Quehenberger)
- Grödig: Manfred Haas (Alt OL Ernst Schörghofer)
- Mühlbach: Wolfgang Haggenmüller (Alt OL Thomas Knöpfler)
Ehrungen – 25 Jahre für die Bergrettung
Geehrt wurden für 25 Jahre Bergrettungsdienst die anwesenden Ortsstellenleiter Johann Schaidreiter (Kleinarl) und Martin Wallinger (Abtenau). Im Land Salzburg gab es 97 Jubilare, davon 13 Bergretter, die bereits über 60 Jahre dabei sind.
72. Landesversammlung in Grödig
So viel Einsätze wie noch nie!












G. Pfluger (Ref. Ausbildung /Ausrüstung)




Am vergangenen Wochenende hielt die Bergrettung Salzburg in Grödig die 72. Landesversammlung ab und zog Bilanz: Die Einsätze steigen, während die Finanzsituation angespannt bleibt. LH-Stv. Christian Stöckl will die Förderrichtlinien für die Bergrettung auf „neue Füße stellen.“
Mit 694 Einsätzen im Jahr 2018 hatte die Bergrettung Salzburg so viele Einsätze wie noch nie zuvor (2017: 637 Einsätze, 2016: 535). Insgesamt leisteten die rund 1.400 Bergretter und Bergretterinnen im Vorjahr 9.754 Einsatzstunden.
Der Boom an Menschen, die ihre Freizeit in den Bergen verbringen, hält an. So gab es für die ersten Monate des Jahres 2019 bereits über 200 Einsätze zu verzeichnen. Die meisten Einsätze finden jedoch während der Sommermonate im Juli (101) und August (121) statt. Die häufigsten Unfallursachen sind nach wie vor das Ausrutschen, Stürzen und Stolpern im Wandergelände. 51 Prozent der Einsätze betrafen gestürzte und rund 14 Prozent verirrte Personen.
Der klassische Einsatz im Fels und Eis macht nur einen geringen Anteil der Einsätze aus, ebenso die Bergung von Lawinenopfern. Hier sind die Einsätze mit rund einem Prozent gegenüber dem Jahr 2017 gleichgeblieben. Bereits 20 Prozent aller Einsätze erfolgten in der Dunkelheit. 28 Menschen konnten im Jahr 2018 von den Bergrettern nur mehr tot geborgen werden. Im Jahr 2017 waren es mit 38 Toten um zehn mehr als 2018.
Wander- und Mountainbike-Boom spiegelt sich in Einsatzstatistik wider
Zahlreiche Ausrückungen betrafen die Bergung von verunglückten Skifahrern (rund 25 Prozent der Einsätze) und Wanderern bzw. Bergsteigern (rund 36 Prozent). Auffallend ist, dass die Einsätze wegen verunglückter Wanderer bzw. Bergsteiger im Vergleich zum Jahr 2017 um vier Prozentpunkte gestiegen sind. In der Einsatzstatistik spiegelt sich auch der steigende Mountainbike-Trend. Die Einsätze stiegen hier von rund vier Prozent im Jahr 2017 auf rund zehn Prozent im Jahr 2018 an.
Verteilt auf die Bezirke waren die häufigsten Einsätze wieder im Pongau (285), gefolgt vom Pinzgau (245), Flachgau (98), Tennengau (37), Lungau (29) zu leisten.
Auffallend im „Bezirksranking“ ist der konstante Anstieg von Einsätzen für Wanderer in Bergnot im Flachgau.
Die Bergretter leisten neben den Einsätzen noch tausende ehrenamtliche Stunden (98.985 Stunden) für eine anspruchsvolle Aus- und Fortbildung. Ein fertig ausgebildeter Bergretter muss vier Kurse absolviert haben. „Wir sind stolz auf das hohe Niveau unserer umfassenden Ausbildung, die jeweils mit einer Prüfung abgeschlossen wird“, erklärte Landesleiter Balthasar Laireiter. So stehen in der Bergrettung Salzburg auch die unterschiedlichsten Spezialisten aus Hundeführern oder Canyoningrettern 24 Stunden in Einsatzbereitschaft.
Neuwahlen: 100 Prozent Zustimmung
Bei der Landesversammlung wurden auch der Landesleiter Balthasar Laireiter und sein Pinzgauer Stellvertreter Klaus Wagenbichler (mit 100 Prozent der Stimmen) wieder gewählt; genauso wie das Team der acht ehrenamtlichen Referenten (aus Ausbildung, Hundewesen, Medizin, Finanzen, EDV, Recht, Presse und Technik – ebenso mit 100 Prozent Zustimmung).
Ehrungen, Jubiläen, neue Funktionäre und Ehrengäste
Geehrt wurden der zurückgetretene Funktionär Coen Weesjes (ehem. Bezirksleiter Pongau) sowie für 50 Jahre Georg Eberharter (Krimml) sowie für 40 Jahre Bergrettungsdienst die anwesenden Ortsstellenleiter Roland Pfund (Bad Gastein), Peter Nothdurfter (Krimml) und für 25 Jahre Franz Waltl (Enzingerboden).
Gerhard Kremser freut sich auf sein neues Amt als Bezirksleiter des Pongaues. Markus Rettenwender übernimmt die Funktion des Ortsstellenleiters in Hüttschlag.
Als Ehrengäste begrüßte LL Laireiter LH Dr. Christian Stöckl, Mag. Reinhold Mayr (BezHauptmann Salzburg-Umgebung), HR. Mag. Burghard Vouk (LPD Stv. Salzburg), Johannes Neuhofer (OBR LFW Verband Salzburg), Richard Hemetsberger (BM Grödig), LL Monika Feichtner und LLStv. Hans Günther (Höhlenrettung), Ing. Estolf Müller (Alt Landesleiter), Coen Weesjes (Alt Bez. Leiter Pongau)
Angespannte Finanzsituation Bergrettung Salzburg
„Nach wie vor angespannt ist jedoch die finanziellen Situation für unsere Einsatzorganisation“, so der Finanzreferent der Bergrettung, Martin Malter. „Obwohl wir extrem sparen, wären dringend höhere Zuschüsse nötig, um die hochqualitative Arbeit weiterhin aufrecht erhalten zu können.“ Dazu Landesleiter Laireiter: „Die Bergretter finanzieren sich einen Großteil ihrer Ausrüstung selbst. Dass sie beispielsweise auch ihre privaten Fahrzeuge für Einsätze verwenden müssen, ist nicht mehr zeitgemäß.“ Hier wäre ein Zuschuss seitens der öffentlichen Hand sehr hilfreich. Für den Großteil an finanzieller Unterstützung kommen die Fördermitglieder und Sponsoren der Bergrettung auf.
Seit Jahren legt die Bergrettung Wert auf präventive Aufklärungsarbeit. „Ob es in der Wintersaison die Aufklärungsarbeit zu Risikomanagement im Bereich Lawinenkunde ist, oder ob es um Sicherheitsstandards am Berg geht – die Menschen schätzen erfreulicherweise unsere Informationen und nehmen sie auch ernst“, betonte der Landesleiter, der auf einen wichtigen Punkt hinweist: „Leider sehen wir durch die ansteigenden Einsätze auch immer wieder Probleme der Verunglückten mit den Einsatzkostenverrechnungen. Gerade bei Sucheinsätzen oder wenn ein Hubschraubereinsatz nötig ist, sind schnell hohe Einsatzkosten erreicht.“
Um 28 Euro versichert
Auch wenn alle Bergretter und Bergretterinnen ehrenamtlich arbeiten, erfordern eine fundierte Ausbildung und modernste Materialien einen stetig wachsenden, hohen finanziellen Einsatz. „Aus diesem Grund möchte ich unbedingt auf die Möglichkeit einer Förder-Mitgliedschaft bei der Bergrettung aufmerksam machen. Denn was viele Wanderer und Bergsportler immer noch nicht wissen: Für einen Unfall in den Bergen kommt nicht die normale Versicherung auf, es wird hierfür eine Zusatzversicherung bzw. eine Versicherung bei alpinen Vereinen benötigt“, so Laireiter.
Die Bergrettung Salzburg bietet hierfür eine Fördermitgliedschaft an: Für 28 Euro jährlich sind Sie, Ihr Partner und Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt versichert. Im Fels, im Eis, auf der Piste und am Wanderweg.
Wie finanziert sich die Bergrettung?
Die Finanzierung des ehrenamtlichen Bergrettungsdienstes steht derzeit auf fünf Säulen:
25 % öffentliche Hand (Gemeinden, Land)
30 % Förderer
20 % Bergekosten
15% Sponsoren und Spenden
10% eigene Veranstaltungen
Neuer Gesetzesentwurf geplant
„Ich plane einen Antrag für einen neuen Gesetztesentwurf im Landtag“, versprach LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP) der Bergrettung Salzburg. Stöckl ist seit Anfang des Jahres im Gesundheitsressort für die Bergrettung verantwortlich und besuchte gemeinsam mit dem Flachgauer Bezirkshauptmann Reinhold Mayer und weiteren Ehrengästen die Landesversammlung am Samstag in Grödig. „Die Förderungen für die Rettungsorganisationen sollen auf neue Füße gestellt werden.“
Bericht/Bilder: Maria Riedler
 Wolfgang Gadermayr, Richard Freicham, Joachim König (von links)
Wolfgang Gadermayr, Richard Freicham, Joachim König (von links)